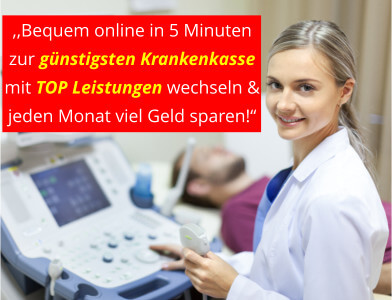Nachbarschaftliche Kontroversen um Grenzabstände
Grenzabstände aufgrund unzulässiger Grenzbebauungen oder Grenzbepflanzungen führen immer wieder zu Kontroversen zwischen Nachbarn.
Eigener Erfahrung nach kann auch ein Schlichtungstermin nur zu einem einseitig schwer nachvollziehbarem Vergleich führen, wenn der Schiedsmann der Thematik nicht sachkundig ist, sich aber dennoch berufen fühlt, rechtliche Aussagen zu tätigen.
Dies wird insbesondere deutlich, wenn der Schiedsmann der Ansicht ist, die rechtlichen Einschätzungen aller Richter bereits im Vorfeld zu kennen und diese entsprechend zu bennenn und zu bewerten.
Besonders nachteilig und entgegen des Sinnes der Schiedsverhandlung wird es, wenn jene rechtlichen Aussagen des Schiedsmannes dazu geeignet sind, ein falsches Rechtsverständnis einer Partei einseitig (zumindest vermeintlich) zu stärken.
Somit trägt auch der Schiedsmann - entgegen seiner Bestimmung - zu einer einseitigen Bewertung bei, die einen objektiven Vergleich torpediert.
Wie viel Abstand eingehalten wird
Wie viel Abstand zur Grenze eingehalten werden muss, wird recht einfach im § 42 NachbG NRW (Grenzabstände für Hecken) geregelt.
So ist folgender Abstand zur Grenze einzuhalten:
a) über 2 m Höhe -> 1,00 m
b) bis zu 2 m Höhe -> 0,50 m
Von wo der Abstand gemessen wird
Hierzu führt der § 46 NachbG NRW (Berechnung des Abstandes) sehr verständlich und einfach zu lesen aus:
"Der Abstand wird von der Mitte des Baumstammes, des Strauches oder des Rebstockes waagerecht und rechtwinklig zur Grenze gemessen, und zwar an der Stelle, an der der Baum, der Strauch oder der Rebstock aus dem Boden austritt. Bei Hecken ist von der Seitenfläche aus zu messen."
Auch der Verband Wohneigentum NN e.V. führt dazu verständlich aus:
"Eine Besonderheit ist die Abstandsregelung bei Hecken. Hier wird der Abstand nicht von der Mitte der Pflanze berechnet, sondern von der zu erwartenden Ausdehnung zuzüglich 0,5 m bei Hecken bis 2,0 m Höhe und 1,0 m bei Hecken über 2,0 m Höhe."
Wann ist eine Hecke eine Hecke
Mitunter kommt es vor, dass auch ein Schiedsmann nach Kenntnisnahme des § 46 NachbG NRW aus einer Hecke plötzlich eine reine Pflanze generieren möchte. Dies mitunter unbeachtet der Tatsache, zuvor selbst ständig von einer Hecke geredet zu haben, Fotos eingesehen und im Antrag sowie abschließenden Protokoll ebenfalls immer von einer Hecke zu schreiben.
Dabei ist auch dies ebenfalls eigentlich keine komplizierte Sache und die Definition sehr einfach. U.a. kann man sich hier bei Unkenntnis mit dem Urteil 12 U 162/13 des OLG Karlsruhe vom 25.07.2014 behelfen:
"Maßgeblich für den Begriff der Hecke ist vielmehr das äußere Erscheinungsbild - insbesondere die Geschlossenheit - der Anpflanzung und die vor diesem Hintergrund bestehende Einwirkung auf das Nachbargrundstück, insbesondere etwa durch Lichtentzug."
Auch das AG Gießen erklärt mit seinem Urteil Az.: 41 C 49/14 vom 16.06.2017, dass selbst entsprechend gepflanzte Bäume eine Hecke darstellen:
"Maßgeblich für die Abgrenzung von Hecken zu solitären Anpflanzungen ist allein die Ausbildung eines optischen Dichtschlusses, ohne dass es hierbei auf Art und Häufigkeit des Beschnittes ankommt"
und
"Von einer Hecke im vorstehenden Sinne ist auszugehen, wenn die jeweiligen Pflanzen so dicht in eine Reihe gesetzt werden, dass durch ihr Wachstum eine Geschlossenheit der Pflanzenkörper erreicht wird und nach ihrem äußeren Erscheinungsbild hierdurch der Eindruck einer wandartigen Formation entsteht"
und
"Die hier in Rede stehenden Bäume der Beklagten sind jedoch nicht als Solitäre im Sinne des § 38 HNachbG gesetzt, sondern – worauf die Beklagten zu Recht hinweisen – als Hecke im Sinne des § 39 HNachbG einzuordnen."
Wenn der Abstand zu gering ist
Weist eine Hecke nicht den nötigen Abstand zur Grenze auf, so ist diese umzusetzen oder ein Teil zu entfernen, sodass der vorgeschriebene Abstand zukünftig eingehalten wird.
So wertet bspw. das OLG Karlsruhe mit Urteil 12 U 162/13 vom 25.07.2014:
"Soweit der Grenzabstand der Bambus-Hecke weniger als 0,50 m beträgt, ist das Landgericht zutreffend von einem Anspruch auf Entfernung des betreffenden Teils der Anpflanzung ausgegangen."
Hecken & Zäune nach WEG-Recht
Ähnlich einfach, aber wichtig zu beachten, ist das Setzen von Zäunen und Hecken nach WEG-Recht. Besitzen Eigentümer kein eigens klassisches (echtes) Eigentum sondern erwerben diese nur einen Eigentumsanteil an einer Sache, so sind diese keine Eigentümer sondern Miteigentümer innerhalb einer WEG (Wohnungseigentümergemeinschaft).
Ein Mehrfamilienhaus beispielweise gilt formal juristisch als ein Objekt, welches der WEG gehört. Dies kann auch für die Garagen, Gärten und weiteren Grundstückbestandteile gelten.
Der Miteigentümer erhält Sondernutzungsrechte, bspw. für die Nutzung und Bewirtschaftung des Gartens. Auch der Aufenthalt und die Nutzung innerhalb der Wohnung oder der Garage fällt in den Bereich des jeweiligen Miteigentümers.
Die TE (Teilungserklärung) wiederum gilt innerhalb des WEG-Rechts als eine Art "Grundgesetz". In dieser wird notariell beglaubigt festgelegt, wie bspw. die Gärten aufgeteilt und angelegt sind. Miteigentümer müssen diesen Zustand auch in der Zukunft entsprechnd beibehalten und "betreuen".
Für rechtlich zulässige Änderungen, Umbaumaßnahmen oder aber Maßnahmen, die andere Miteigentümer beeinträchtigen oder in der TE nicht vorgesehen sind, bedarf es einer entsprechenden Abstimmung unter den Miteigentümern und der Verfassung entsprechender Beschlüsse.
WICHTIG: Auch wenn sich Miteigentümer untereinander einig sind und entsprechende Beschlüsse gefasst werden gilt: Die Maßnahmen werden anschließend Teil des Gemeinschaftseigentums. Somit müssen zukünftige Reparaturen und Schäden von allen Miteigentümern bezahlt werden.
Weiter gilt: Werden die Maßnahmen bspw. von einer gemeinsamen Versicherung der WEG (z.B. Wohngebäudeversicherung) gedeckt, so betreffen Selbstbehalte, steigende Prämien aufgrund gemeldeter Schäden oder ein Verlust der Versicherung aufgrund der gemeldeten Schäden ebenfalls alle Miteigentümer.
Fazit: Werden also beispielsweise per Beschluss Markisen angebracht, Bohrungen in die Außenfassaden vorgenommen oder Zäune gesetzt so gehen diese Maßnahmen in das Gemeinschaftseigentum über. Bedeutet, alle Miteigentümer müssen hierfür zahlen und haften.
Rechtswidrige Vorgänge nach WEG-Recht
Erfolgen Maßnahmen, die unter den Miteigentümern nicht abgesprochen wurden und für die insbesondere kein Beschluss vorliegt, so besteht grundsätzlich der Anspruch auf Rückbau.
Dies gilt natürlich insbesondere für bauliche Maßnahmen bzw. Veränderungen.
Das BayObLG hat mit seinem Beschluss BReg 2 Z 32/91 vom 04.07.1991 allerdings bereits richtig erkannt, dass auch Vorgänge, welche keine baulichen Veränderungen darstellen sehr wohl dennoch in das gemeinschaftliche Eigentum eingreifen. Die Eigentumsgemeinschaft hat einen Beseitigungsanspruch, welcher auch durch einen einzelnen Miteigentümer durchgesetzt werden kann.
Hierzu führt das Gericht aus:
"Durch eigenmächtige Anpflanzung wird jedoch in gemeinschaftliches Eigentum eingegriffen; es werden auch Miteigentumsrechte der übrigen Wohnungseigentümer beeinträchtigt, sodass grundsätzlich Beseitigungsverpflichtung nach § 1004 Abs. 1 S. 1 BGB, § 15 Abs. 3 WEG besteht. "
Und weiter:
"Beseitigungsansprüche kann im Übrigen auch ein einzelner Miteigentümer geltend machen."
Die Kirschlorbeer-Hecke
Gerade Kirschlorbeer wird häufig dicht zusammen als Hecke gepflanzt. Somit gehen viele Gerichte und Urteile zurecht von Kirschlorbeerhecken aus.
So beschreiben u. a. die folgenden Urteile verschiedener Gerichte selbstverständlich die Kirschlorbeerhecke:
- OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 14.03.2019 - 22 U 99/17
- LG Baden-Baden, Urteil vom 13.02.2017 - 1 S 10/16
- Amtsgericht München, Urteil vom 08.04.2020 - 155 C 6508/19
Kirschlorbeer - Beton ist ökologisch wertvoller
Kirschlorbeer ist nicht nur für Tiere, sondern auch für Kinder gefährlich.
Das Fruchtfleisch der Lorbeerkirsche schmeckt nämlich angenehm saftig süßlich mit einem nur leicht bitterem Nachgeschmack. Hochgiftig für Kinder, Erwachsene und Tiere sind die in den Beeren enthaltenen Samenkörner. Wird der Samen beim Verzehr der Frucht zerbissen, wird Blausäure freigesetzt und es kann zu Übelkeit, Erbrechen, Schwindelgefühlen und Magenschmerzen kommen. Da Kinder viel empfindlicher auf den Giftstoff reagieren drohen schon beim Genuss weniger Früchte schwere Vergiftungssymptome über die Bewusstlosigkeit bis hin zum Tod durch Atemstillstand.
Der Merkur erwähnt in seinem Artikel vom 13.06.2022 die hohe Giftigkeit. So schreibt der Merkur u. a.:
"dass sie in allen Pflanzenteilen - von Blättern bis hin zu Blüten und Fruchtsamen - giftig ist."
So wurde Kirschlorbeer bereits 2013 zur Giftpflanze des Jahres gekürt. Hierzu wird ausgeführt:
"In der Pflanze befinden sich Glykoside, die beim Zerkauen und Hinunterschlucken zur hochgiftigen Blausäure umgewandelt wird. Das ist besonders gefährlich, da die Früchte im Vergleich zu den Blättern oft süß schmecken und deshalb nicht gleich ausgespuckt werden. Auch Tiere sind durch die Pflanzenteile der Lorbeerkirsche gefährdet."
Auch Sönke Hofmann, Geschäftsführer des Naturschutzbundes Deutschland (NABU), informiert über die Lorbeerkirsche:
"Wer Kirschlorbeerhecken pflanzt, begeht ein Verbrechen an der Natur. Die Pflanze würde Insekten die Nahrungsgrundlage rauben, da sie beheimatete Pflanzen verdrängt und Vögeln nur wenig Unterschlupf bietet."
Weiter wird dazu ausgeführt:
"selbst eine Betonmauer ist ökologisch wertvoller"
In den Nachrichten wurde bereits berichtet, dass mindestens 24 Rehe qualvoll an Kirschlorbeer verendet sind.
Kirschlorbeer-Verbot in Essener Kleingärten
Der Stadtverband der Essener Kleingärtnervereine reagiert bereits und hat verfügt, dass das Giftgewächs Kirschlorbeer nicht mehr angepflanzt werden darf. Von dem Verbot sind rund 8500 Kleingärten betroffen.
Auch eine Stadt im Kreis Gütersloh will sie nun verbieten, andere Städte könnten folgen.